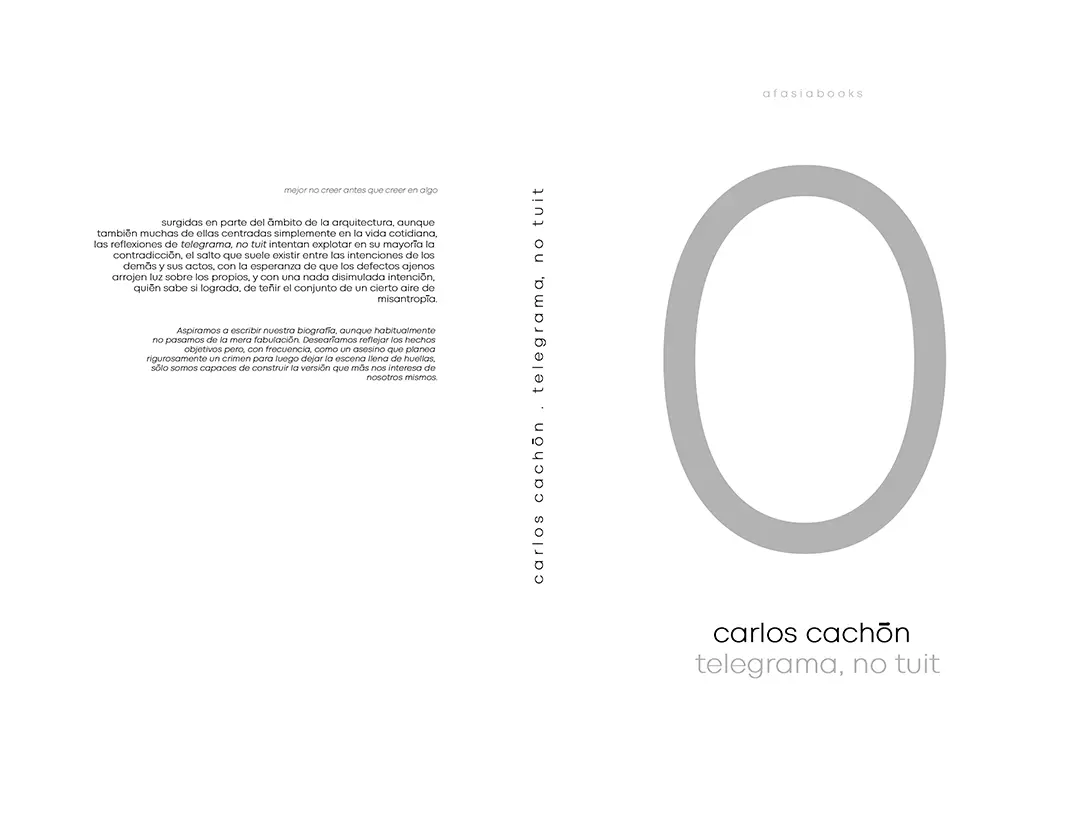Die ursprüngliche Anlage von Rittmeyer & Furrer mit den Gebäuden entlang der zentralen, gepflasterten Mittelachse erzeugt eine räumliche Dichte mit dem kleinstädtischen Charakter eines Weilers oder Dorfes. Im Zusammenspiel mit der ausserordentlichen Lage an der Hangkante hoch über dem Zürichsee, mit Blick auf die Alpen entstand hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein unverwechselbarer Ort, welcher das moderne Therapiekonzept in seinen Bauten und Aussenanlagen bis heute widerspiegelt. Betraut mit der Aufgabe, diese in sich abgeschlossene, historische Anlage den neuen Bedürfnissen anzupassen und zu erweitern, ist es naheliegend, das von Rittmeyer & Furrer angelegte Prinzip weiterzudenken und mit zwei Neubauten das Pavillonkonzept zu ergänzen.
Rochaden im Zuge der Ausführung in mehreren Etappen erlauben Optimierungen bezüglich der Nutzung und klarere Trennungen der Funktionen Wohnen, Therapie, Essen, Geselligkeit und Verwaltung. Diverse Rückbauten späterer Eingriffe und Neuinterpretationen, auch in der Umgebungsgestaltung, führen zu einem neuen Ensemble, das heute selbstverständlich wirkt.
Der Umbau der historischen Bauten erfolgt unter dem Gesichtspunkt weitestgehender Substanzerhaltung und in enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege. Für die neue Zimmerstruktur werden Typologien aus der Zeit der Grandhotels des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu Grunde gelegt. Dabei werden neue Nasszellen und Lift so integriert, dass sie sich harmonisch in die bestehende Struktur einfügen. Die Materialisierung der neuen Einbauten lehnt sich in ihrer Machart am traditionellen Handwerk des Bestandes an.
Beim neuen Empfangsgebäude werden wichtige Themen der historischen Bauten übernommen, aber zugespitzt, verfremdet und neu interpretiert. Gewünscht wird weder der Bruch mit der Vergangenheit, noch wird sie historisierend weitergebaut. Unter dem grossen, weit heruntergezogenen Dach sind der Empfang, Speisesäle für die Patienten und ihre Gäste sowie die Verwaltung untergebracht.
Das Physiotherapiegebäude ist ein vorfabrizierter Holzbau, bei dem mittels einer spezifischen statischen Konstruktion ein stützenfreier, lichtdurchfluteter Raum erstellt wird. Der neu geschaffene Hofraum verbindet Bestand und Neubau und erzeugt eine eigene Stimmung auf der vom See abgewandten Seite. Auch die Nutzung fasst beide Bauten zusammen, da im Altbau ebenfalls Therapieräume angeordnet sind.
Die im Ausdruck eigenständigen Neubauten fügen sich stimmig in die Gesamtanlage ein und orientieren sich in ihrer Materialisierung ebenfalls am handwerklichen Können des Bestandes.
Für die Inneneinrichtung werden ausgewählte Vertreter der Zwanziger- und Dreissigerjahre aus Stahlrohr und Bugholz kombiniert mit zeitgenössischem Mobiliar und diversen eigens für die Hohenegg entworfenen und hergestellten Möbeln, die den hohen Ansprüchen einer heutigen psychiatrischen Privatklinik gerecht werden.
_