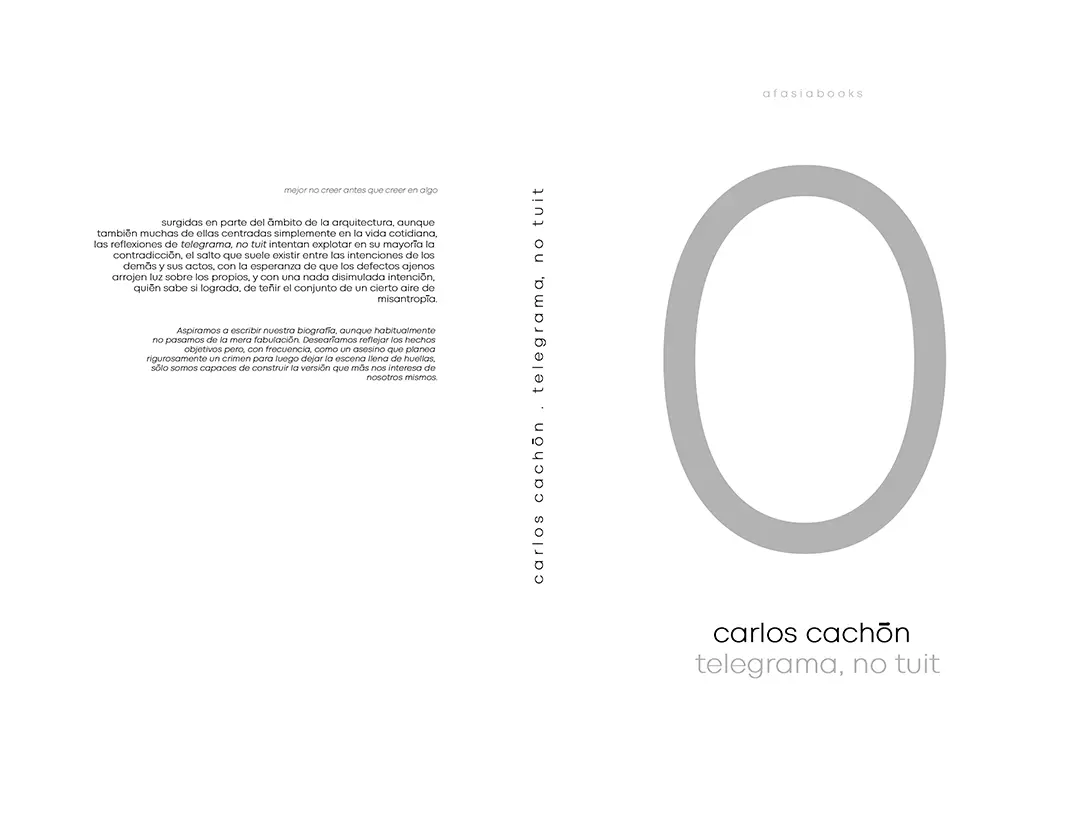Durisch + Nolli . renders: © Filippo Bolognese
Die sehr zurückhaltende Aussenraumgestaltung wird durch die präzise Setzung des Neubaus ermöglicht. Die räumliche Fassung des Landschaftsraumes geschieht durch den Neubau. Die Tragstrukturen und Konstruktionen des Neubaus sind so angelegt, dass sie den Körper in einen Zustand der inneren Spannung und Vibration versetzen. Die wilde Landschaft wird durch die rhythmisierte Architektur verstärkt. Es entsteht ein neuer besonderer Ort. Die Rauheit der Natur und die Klarheit des Baus verschmelzen zu einem ausgewogenen Ganzen. Die Gegebenheiten der Topografie und der Landschaftsräume werden aufgenommen und verstärkt. Die vorhandene Vegetation mit waldartigen Beständen aus Rotbuchen, darin eingestreuten Waldkiefern, grossen Ansammlungen von Lärchen, einzelnen Bergahorne, und dichten Gruppen mit Mehlbeeren werden zu einzigartigen Akteuren und Kulissen im Landschaftsraum. Der Blick vom Lärchenplatz in die Landschaft nach Nordosten ist und bleibt ohne Einschränkung erhalten. Der Ankunftsort wird architektonisch thematisiert, und mit einer Vorfahrt akzentuiert. Die Parkplätze sind seitlich zur Alpenstrasse angeordnet. Das Dach der versenkten Turnhalle wird als Wiesenparterre ausgebildet.
_
Projektziele Das Projekt für die Erweiterung der Hochschule Lärchenplatz HLP in Magglingen ist eine direkte Umsetzung der im Wettbewerbsprogramm festgehaltenen Ziele:
Ein Projekt von hoher architektonischer Qualität zu formulieren, welches sich vorbildlich in den bestehenden Landschaftsraum des Lärchenplatzes einfügt.
Ein architektonisch hochwertiges Bauprojekt für das nationale Kompetenzzentrum für sportwissenschaftliche und sportmedizinische Dienstleistungen und Forschung im Leistungssport zu entwerfen.
Die Bereiche Sportmedizin und –Physiotherapie, Leistungsdiagnose und Messhalle, sowie Sportpsychologie, Trainerbildung und Trainingswissenschaft sollen auf dem Areal Lärchenplatz betrieblich zusammengeführt werden. Optimale Betriebsabläufe und hohe Arbeitsplatzqualität sind gefordert.
Die Raumbehaglichkeit im Gebäude soll die Anforderungen der jeweiligen Nutzung bezüglich visuellem, akustischem und thermischem Standard, sowie hinsichtlich Luftraumqualität erfüllen. Energiekennwerte sollen mindestens Minergie® P erreichen. Das Label „Gutes Innenraumklima GI“ wird verlangt.
Wirtschaftliche Erstellungs- und Betriebskosten, Flexible Grundrisse, pflegeleichte und langlebige Materialien sind wichtige Ziele bezüglich Nachhaltigkeit.
Es ist ein Bauen unter Betrieb mit zeitnahen Bauetappen vorgesehen. Mit geschickter Ausnutzung soll das Areal für spätere Entwicklungen offen gehalten werden. In einer Volumenstudie soll die spätere Anlage einer Dreifachsporthalle untersucht werden.
Objekt
Das Projekt ist einerseits direkt aus dem Ort heraus entwickelt, indem es dank niedriger Bauhöhe, die nur eingeschossig über die Ebene des Sportplatzes ragt und dem von der filigranen, modular rhythmisierten Fassade bestimmten Ausdruck zusammen mit dem Wertvollen Baumbestand eine nach Nordosten sich öffnende, natürliche Arena bildet: es entsteht trotz grossem Bauvolumen ein Ort der Ruhe der zur Bewegung in der Natur einlädt.
Andererseits trägt das projektierte Gebäude sozusagen das Wissen um die „Bieler Schule“ und um seinen kürzlich verstorbenen wichtigen Vertreter Max Schlup in sich, indem es in einer völlig neuen Auslegung wertvolle, nachhaltige Bauten wie das kürzlich renovierte BASPO Schulgebäude oder das Bieler Gymnasium als historische Vorläufer versteht.
Die Gebäudetypologie und das strukturelle Konzept sind so ausgelegt, dass ein Höchstmass an Flexibilität in der Nutzung des neuen Gebäudes gewährleistet ist. Das neue Kompetenzzentrum wird in einem kompakten, langgezogenen Neubau untergebracht, der sich parallel zur Laufbahn möglichst klar und exakt in die Umgebung einfügt.
Den klar formulierten Projektzielen und Funktionsdiagrammen entspricht eine klare Gebäudetypologie:
Der langgezogene Neubau, analog seinem Vorgänger sorgfältig in den Hang des Lärchenplatzes eingelassen, erlaubt eine Beschränkung der Gebäudehöhe auf 3 Geschosse, und wird somit bergeseitig als eingeschossiger, filigraner Pavillonbau wahrgenommen.
Die klare, grosszügige und modulare Struktur, mit einem völlig stützenfreien Zwischengeschoss für die Leistungsdiagnose und die Sportphysiotherapie, erlaubt eine nahezu totale Flexibilität in der Anordnung der Hallen- und Laborräume, dessen Layout zu jeder Zeit frei den Nutzeranforderungen angepasst werden kann.
Die besondere Gebäudetypologie erlaubt eine differenzierte Auslegung der Geschosse, und damit eine optimale Anpassung an die nutzerspezifischen Bedürfnisse. Entsprechend dem Funktionsdiagramm und dem im Pflichtenheft formulierten Raumbedürfnissen sind die Inhalte auf 3 Niveaus verteilt, wobei jedes Niveau optimale Bedingungen für die entsprechende Funktionsgruppe bietet.
Im Sockelgeschoss mit grosszügigem Eingangsportikus sind Empfang / Foyer, Ausbildungsräume, die Halle Regeneration mit den Wasserbecken für die Hydrotherapie, Garderoben, Technik- und Lagerräume untergebracht.
Im vollständig Stützenfreien Zwischengeschoss sind die Hallenartigen Räume der Sportphysiotherapie und der Leistungsdiagnose untergebracht. Diese sind klimatisch und lichttechnisch sinnvoll durch die Erschliessung von den Fassaden losgelöst. Die flexibel unterteilbaren Hallenräume liegen im Inneren, die Erschliessung erfolgt ringsum übe reine Gangstruktur, die zugleich als thermischer Puffer fungiert.
Im Obergeschoss sind, entsprechend einem optimalen Raster (2.70m) und einem Layout basierend auf der vom BBL suggerierten, optimalen Grundrisstypologie, sämtliche Büros und administrativen Nutzungen untergebracht.
Dieses klare, präzis ausformulierte typologische und strukturelle Konzept gewährt eine optimale Funktionalität und eine entspricht so auf ideale Weise auch den formulierten Nachhaltigkeits-Kriterien.
Die langgestreckte, grosse Dachfläche erlaubt die einfache, grossflächige Installation von niedrigen Photovoltaikpaneelen ohne das architektonische Konzept und das Landschaftsbild zu beeinträchtigen.
Die weite Auskragung des Zwischengeschosses über den Eingangsbereich bildet einen grosszügigen, gedeckten Aussenraum, der gleichzeitig auch Eingangsportikus für die zukünftigen, in den Hang versenkten Dreifachturnhalle ist.
Struktur
Im Rahmen der Erweiterung der Hochschule Lärchenplatz HLP des Bundesamtes für Sport in Magglingen wurde ein langgezogenes Gebäude entwickelt, das sich kontextuell entlang der Geländekante in die Umgebung einfügt. Der architektonische und strukturelle Ausdruck lehnt sich an die „Jurasüdfussarchitektur“ an mit den Bekannten Vorreitern wie Max Schlup und Franz Füeg. Es ist angedacht mit einer industriell vorgefertigten Bauweise ein filigranes Bauwerk zu planen, welches eine hohe Flexibilität in der Nutzung aufweist. Die Anordnung der unterschiedlichen Nutzungen erfolgt nach funktionalen Kriterien unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Topografie und wird im Tragwerkskonzept konsequent umgesetzt.
Das dreigeschossige Gebäude ist 19m Breit und weist eine Gesamtlänge von ca. 146m auf. Drei Kerne, die sich über die gesamte Gebäudehöhe erstrecken, bilden die Wirbelsäule der Struktur. Sie gewährleisten die Stabilität des Gebäudes gegen horizontale Beanspruchungen wie Wind- und Erdbeben.
Die unterste Ebene ist als massive, teilweise ins Erdreich eingelassene Struktur ausgelegt. Dieser Sockel besteht aus innen- und aussenliegenden Tragwänden, die eine 30 cm starke Betondecke tragen. Diese Bauweise gewährleistet die notwendige Nutzungsflexibilität und einen wirtschaftlichen Einsatz von Recycling-Baumaterialien im Sichtbeton.
Die zwei Obergeschosse sind als ein zusammenhängendes strukturell vorgefertigtes System konzipiert. Sie sind leichter und grosszügiger ausgelegt, um eine maximale Flexibilität in der Disposition der unterschiedlichen Hallen zu gewährleisten. Die Struktur weist in Längsrichtung ein Achsraster von 2.7 m auf. Fassadenseitig tragen Stützen mit einem Querschnitt von 27 x 54 cm in diesem Raster die Lasten auf den Betonsockel ab.
In Längsrichtung ist das Tragwerk in zwei unterschiedliche strukturelle Bereiche aufgeteilt: die zweigeschossigen Haupthallen erstrecken sich auf einer Länge von ca. 40m. Die Decke ist als eine vorgefertigte, vorgespannte Betonstruktur konzipiert, die aus der Aneinanderreihung von Rippenplatten mit 40cm starken und 90cm hohen Rippen und einer 10cm dicken Platte besteht. Nach dem Versetzen werden diese vor Ort mit einem Überbeton von 10cm zu einer zusammenhängenden Deckenkonstruktion verbunden. Der zweite strukturelle Bereich besteht aus zwei übereinander liegenden Geschossen. Im obersten, als Bürogeschoss ausgelegten Niveau sind, basierend auf dem Achsraster im Raum zwei weitere Stützenreihen (40x70cm) angeordnet. Die biegesteife Ausbildung dieser Stützen bildet zusammen mit den Betonrippen (40x55cm Querschnitt) der Decken eine „Vierendeel“ Tragstruktur. Dies erlaubt die gesamte Höhe des Bürogeschosses statisch zu nutzen. Dadurch entsteht im darunter liegenden Zwischengeschoss auf der gesamten Länge ein stützenfreier Raum. Diese räumliche Optimierung resultiert aus dem effizienten statischen Konzept. Die Vierendeelträger werden vorzugsweise liegend auf dem Platz produziert und anschliessend mit einem Pneukran in die vertikale Soll-Lage montiert.
Im Eingangsbereich kragen die Obergeschosse etwa 16m über das Sockelgeschoss aus. Die fassadenseitig angelegten Diagonalen bilden ein zweigeschossiges Fachwerk, das die notwendige Aussteifung gewährleistet. Die Decken tragen die horizontalen Kräfte bis zu den Betonkernen ab. In Querrichtung ist die untere Decke dank filigranen Stützen an die Vierendeelträger des Bürogeschosses aufgehängt.
Bauablauf und Etappierungen
Der Neubau ist in struktureller und typologischer Hinsicht so konzipiert, dass eine Realisierung in 2 Etappen möglich ist. Dabei ist die Realisierung der ersten Etappe ohne Abbruch des Hauptbaues möglich. So können sämtliche Aktivitäten im Hauptbau während dem Bau der ersten Etappe ohne funktionelle Einschränkungen aufrecht erhalten werden. Der Neubau ist so gegliedert, dass die Funktionsbereiche des Hauptbaus nach Fertigstellung der ersten Etappe in den Neubau transferiert werden können und dort ihre definitive Disposition finden. In einer zweiten Etappe kann der Hauptbau zurückgebaut werden und in einer 2. Etappe das neue Kompetenzzentrum mit der neuen Messhalle fertiggestellt werden.
Die klare Struktur erlaubt eine Realisierung in zeitnahen Etappen und ein Bauen unter Betrieb.
Energieeffizienz
Das Projekt ist schon vom Konzept her auf eine optimale Energieeffizienz ausgerichtet. Die klare, einfachen Struktur und Typologie wird ein klares Haustechnik-Konzept entsprechen, das in der Projektphase mit den entsprechenden Fachplanern entwickelt werden kann. Die klar differenzierte und lokalisierte Anordnung der unterschiedlichen Nutzungstypologien innerhalb des Gebäudevolumens erlaubt eine entsprechend gezielte Differenzierung der Haustechnikkonzepte für grundlegend verschiedenen Nutzungsberieche.
Der installationsintensive Bereich der Hallen der Leistungsdiagnose und Sportphysioterapie, die idealerweise im Zwischengeschoss untergebracht sind, kann dank den umlaufenden klimatischen Pufferzonen der Korridore optimal belüftet und mit dosiertem Tageslicht belichtet werden.
In den Büros im Obergeschoss können einfache moderne Haustechnikkonzepte, wie dezentrale Lüftungselemente (Airboxen), Thermoaktive Deckenpaneele (TAPS) mit integrierten Massnahmen zur Optimierung der Raumakustik und Tageslichtabhängige Stehleuchten zur Anwendung kommen.
Die zum Teil ins Erdreich eingelassenen Haustechnikräume, Archive, Lagerräume und Garderoben sind im Sockelbereich optimal angeordnet.
Das Flachdach bietet mit seiner Fläche von 2800 m2 mit einer nach Süden ausgerichteten, 140 m langen Front, optimale Bedingungen für die Einrichtung einer Photovoltaik-Anlage.
Die Maximierung der Nutzung von erneuerbaren Energien (Geothermik, Wärmepumpen, Rückgewinnung) ist ebenso ein Muss, wie die Erreichung der Minergie P Zertifizierung und des GI Labels.