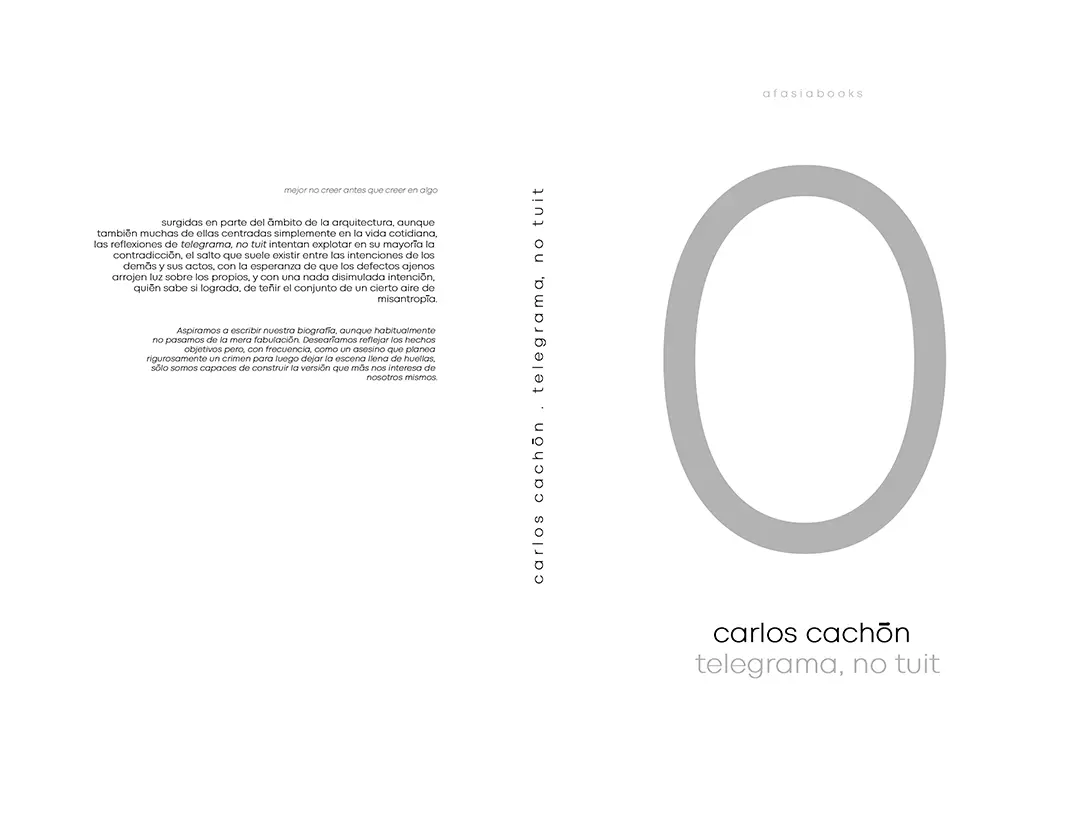Camponovo Baumgartner . photos: © Sven Högger
Where, almost a hundred years ago, brass instruments once filled the air with orchestral sounds from a skillfully crafted grandstand, today, different dramatic movements are taking place: those of physical exercise. The restoration of the Music Pavilion Sihlhölzli, built in 1932 by city architect Hermann Herter and engineer Robert Maillart, not only marks the farewell to the pavilion’s expressive era as a place of music but also brings a historically significant building, relevant in architecture and engineering, back to a sporting public after decades of practical disuse. Together with the Sports Office, the city of Zurich has decided to renovate the listed concrete shell structure and provide a calisthenics facility along with changing rooms. Exactly 85 years ago, it was referred to in the local Wiediker Post as a “famous splendid shell”; today, the building is undoubtedly splendid and perhaps a bit punk.
Repurposing and Renovation for a Calisthenics Facility
Metal sports equipment sets off a dense, rhythmic choreography on a fire-red-orange speckled rubber granulate surface. The monolithic-looking yet easily removable sports platform is shaped from a wooden and steel substructure: like a tongue, it lies within the shell, which is opened wide, presenting the users of the facility. To prevent nighttime vandalism, the sports area is enclosed by fine, dark green posts with stainless steel balls and salmon-colored wave grids, finished with elliptical arches, following the historical balustrades. The shapes and colors complement the oiled Oregon wood of the grandstand’s interior, the age-related green patina of the boldly overhanging copper-covered oval, and the scratched concrete of the acoustically shaped, massive rear wall. The term “musculus” applies not only to the retained form but also to the new use: shell is musculus is muscle.
Access to the changing rooms is via two side pergola-like exits. Like feelers extending outward, the steel structures welcome the users. In contrast to the weather-protected, powder-coated, and painted grids and supports, these are hot-dip galvanized and appear naturally washed. The sobriety, which is almost technoid due to the precisely installed round lights, leads into a lower world that holds fresh discoveries. The excavated basement surprises with brightness, lightness, and visual spaciousness. A salmon-colored, sculptural metal installation, meticulously hand-painted, radiates outward and houses WC and shower cabins, adding its own spatial layer to the shell-shaped floor plan. The cabins are spacious enough to be divided into two areas through a change in flooring. Its sea-green color serves as a lower finish and references the oxidized copper roof from the time of construction. Together with the cabins, several slender supporting columns form the centerpiece of the changing rooms, around which wide arch doors pivot and where specially designed, 3D-printed lights referencing an old model are installed. The tall, cuff-like door hinges, which were pearl-like slipped over the structural elements before their installation, challenge the usual hierarchy of architecture and structure.
Above the cabins, generous mirror surfaces frame the space. Visually, they indicate the actual size of the divided room. The remaining surfaces on the ceiling and walls are coated in fine lime plaster and adorned with vertical wall panels that move in the surface. The rooms are completed by lockers that hug the outer wall in a corset of prefabricated steel frames. Their white color shifts between wall profile and new layer.
The restoration of Sihlhölzli is an approach to the architectural forms and elements of related buildings by Hermann Herter, adapted to the existing engineering art of Robert Maillart. We say: “Let the muscles play,” and hope for a long lifespan of this delicate heritage.·
Text by Fabian Tobias Reiner
_
Wo vor fast hundert Jahren auf einer geschickt gezimmerten Tribüne Blasinstrumente zum Orchesterklang ansetzten, werden heute andere dramatische Bewegungen vollzogen: die der körperlichen Ertüchtigung. Durch die Instandsetzung des Musikpavillons Sihlhölzli, 1932 erstellt vom Stadtbaumeister Hermann Herter und dem Ingenieur Robert Maillart, wurde nicht nur die im Ausdruck prägende Ära des Pavillons als Ort der Musik verabschiedet, sondern ein geschichtsträchtiger, architektur- und ingenieurtechnisch-relevanter Bau nach Jahrzehnten der praktischen Nichtbenützung einer sportlichen Öffentlichkeit zugeführt. Gemeinsam mit dem Sportamt hat die Stadt Zürich entschieden, den denkmalgeschützten Betonschalenbau zu überholen und eine Calisthenics-Anlage mitsamt Garderobenräumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Vor genau 85 Jahren noch in der lokalen Wiediker Post als «famose Prunkmuschel» betitelt, ist das Gebäude heute ganz sicher Prunk und vielleicht auch ein bisschen Punk. Metallische Sportgeräte setzen auf einem feuerrot-orange gesprenkelten Gummigranulat zu einer dichten, rhythmischen Choreografie an. Das monolithisch wirkende, jedoch jederzeit rückbaubare Sportpodest ist aus einem Unterbau aus Holz und Stahl geformt: Wie eine Zunge liegt es in der mit grossem Atem geöffneten Muschel und präsentiert die Nutzenden der Anlage. Um nächtlichen Vandalen vorzubeugen, ist der Sportbereich durch feine, dunkelgrüne Pfosten mit Edelstahlkugeln und lachsrote, mit elliptischen Bögen abgeschlossenen, Wellengittern begrenzt, welche den historischen Brüstungen folgen. Die Formen und Farben ergänzen das geölte Oregonholz des Tribüneninnenraumes, den altersbedingten Grünspan des kühn überhängenden kupferbedeckten Ovals und den scharrierten Beton der akustisch geformten, massiven Rückwand. Der Begriff des Musculus gilt dabei nicht nur der behaltenen Form, sondern gleichsam der neuen Nutzung: Muschel ist Musculus ist Muskel. Zu den Garderoben gelangt man über zwei seitliche pergolaartige Abgänge. Wie Fühler nach aussen ausgestreckt, holen die Stahlstrukturen die Nutzenden ab. Entgegen der wettergeschützten, pulverbeschichteten und gestrichenen Gitter und Stützen sind diese feuerverzinkt und wirken natürlich abgewaschen. Die Nüchternheit, die durch die präzis eingebrachten Rundleuchten fast schon technoid wirkt, führt in eine Welt nach unten, welche eine frische Entdeckung bereithält. Das eingegrabene Untergeschoss überrascht mit Helligkeit, Leichtigkeit und optischer Weite. Ein lachsroter, plastischer Metalleinbau, minutiös handgestrichen, welcher sich radial ausbreitet und WC- und Duschkabinen beherbergt, schreibt dem muschelförmigen Grundriss eine eigene Raumschicht ein. Die Kabinen sind grosszügig genug, um über einen Bodenbelagwechsel in zwei Bereiche unterteilt zu werden. Dessen seegrüne Farbe gilt als unterer Abschluss und referenziert das bauzeitliche, oxidierte Kupferdach. Gemeinsam mit den Kabinen bilden mehrere schlanke, tragende Stützen, um welche breite Bogentüren pivotieren und wo die eigens, an ein altes Vorbild referenzierten, 3D-gedruckten Leuchten angebracht sind, das Kernstück der Garderoben. Die hohen, manschettenartigen Türscharniere, welche den strukturellen Elementen noch vor deren Einbau perlenartig übergestülpt wurden, fordern dabei die gewöhnliche Hierarchisierung von Architektur und Struktur heraus. Oberhalb der Kabinen fassen grosszügige Spiegelflächen den Raum. Optisch weisen sie auf die tatsächliche Grösse des zweigeteilten Raumes hin. Die restlichen Oberflächen an Decke und Wand sind in feinen Kalkputz getüncht und mit vertikalen, in der Oberfläche bewegten Wandplatten bekleidet. Vollendet werden die Räume durch Schliessfächer, die sich in einem Korsett aus vorgefertigten Stahlrahmen der Aussenwand entlang schmiegen. Durch ihr Weiss changieren sie zwischen Wandprofil und neuer Schicht. Die Instandsetzung Sihlhölzli ist eine Annäherung an die architektonischen Formen und Elemente verwandter Bauten Hermann Herters, angepasst an die vorgefundene Ingenieurskunst Robert Maillarts. Wir sagen: «Lasst die Muskeln spielen», und hoffen auf eine lange Lebensdauer eines empfindlichen Erbes. Text von Fabian Tobias Reiner