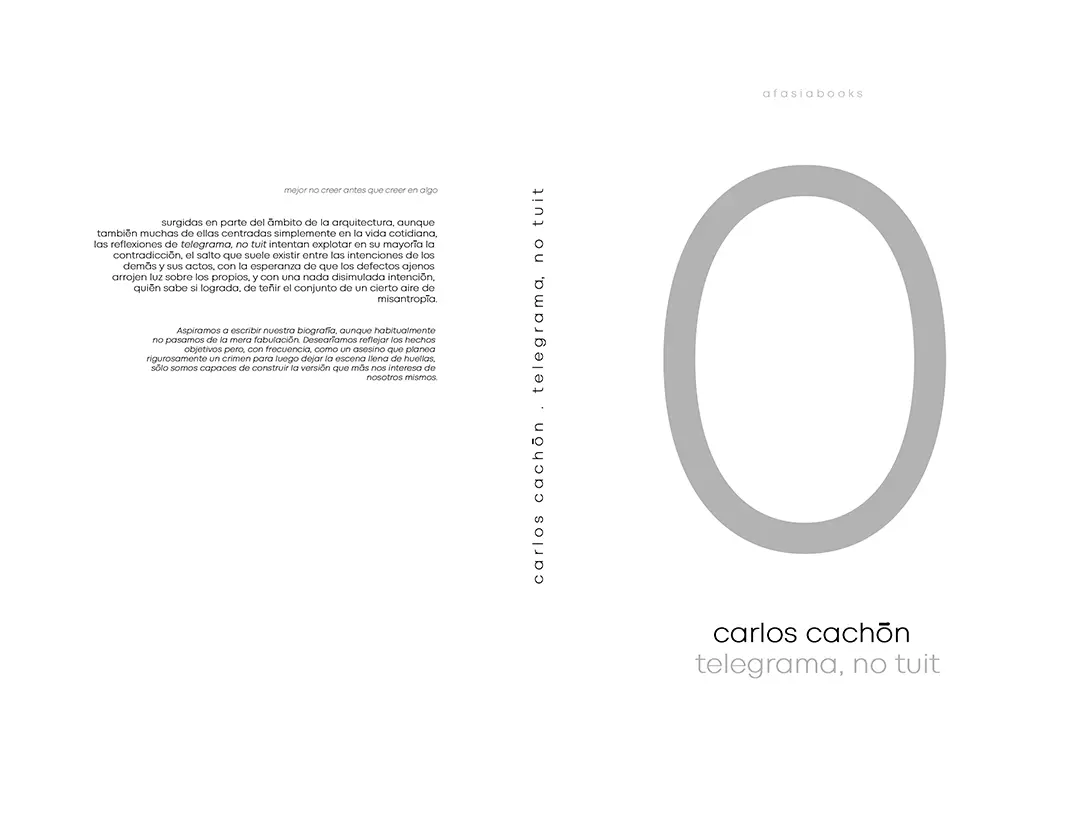In der ehemaligen Klosterstädte Burghasungen, nahe zu Kassel befindet sich der letzte Ruheort des heiligen Heimerads wieder. Der heilige Heimerad war ein ein- facher Priester, der sich schließlich nach seinen Erkundungen durch Rom und Jer- sualem in Hessen niederlässt. Nahe zum Burghasunger Berg bildet sich zu Beginn des 10. Jahrhunderts das Kloster Burghasungen. Das Kloster, in seiner präsenten Lage,im Himmel schwebend, wird schnell zu einem reichen und kulturstiftenden Ort, Pilger kehren ein um die letzte Ruhestätte des heiligen Heimerads zu erkun- den und den Berg zu besteigen. Das Kloster wird zum tragenden Fundament für die Kultur und die Entwicklung des Dorfes.
Zu Beginn der Reformation und im Laufe des 30 jährigen Krieges scheint auch der einst vorhandene Glanz des Dorfes begraben zu sein. Das Kloster wird im Zuge dessen verlassen und verfällt langsam, in vielfachen Plünderungen verliert es seinen ideologischen und materiellen Reichtum und steht nur noch als Fragment am Berge. Ende des 19. Jahrhunderts schlägt ein Blitz in den ehemaligen Kirchen- turm und zerstört die Wallfahrtsstätte endgültig.
Heute ist Burghasungen ein kleines Dorf, mit gar 900 Einwohnern, trotz der we- nigen Überreste des Klosters besteht ein großes Interesse die bestehenden Frag- mente des heiligen Heimerads und seiner Überreste zu bewahren.
Die Bühne für diese Geschichte beschäftigt sich mit der respektvollen Wahrung der Geschichte eines Ortes. Was fasziniert uns an Bauwerken, was führt uns im- mer wieder an besondere Stätte, zieht uns magisch an bestimmte Orte? Es sind die Geschichten und Spuren der gebauten menschlichen Umgebung, die einen an- oder abstoßen. Ihnen einen angemessenen Rahmen, einen angemessenen Raum zu geben. Der Politiker und Nobelpreisträger Sir Winston Churchill soll sinngemäß einmal gesagt haben: „Erst gestaltet der Mensch seine Umwelt, dann die Umwelt den Menschen“ und bringt damit unser Denken und Fühlen auf den Punkt.
Bei der ehemaligen Klosterstätte, auf dem Burghasunger Berg wird ein Refugi- um für die Klostersteine und den heiligen Heimerad errichtet. Ein Archiv für die Kunst und die Geschichte, Leitmotiv des Entwurfes ist der Wissensspeicher.
Der Wissensspeicher begrenzt das Plateau zum Norden hin und öffnet sich zur Weite des Tals, in denen man in Lichtungen, zwischen den einzelnen Baumstäm- men die Ferne erkennt. Klar gegliederte Pilaster bestimmen die markante Fassade und formen die tragende Struktur. Eingestellte Wandscheiben differenzieren zwi- schen offenen und geschlossenen Räumen. Eine eingestellte Ebene bildet dabei den Abschluss des Daches. Das Gebäude erinnert an alte Architekturen, Tempel- artige Gebilde, Urformen der Architektur.
Wir betreten das Gebäude durch eine großzügige Vorhalle, zu beiden Richtun- gen blicken wir hinaus in die Weite der Landschaft, ein gerahmter Blick. Zu den Seiten öffnen sich zwei Räume. Im ersten Raum wird die Geschichte der Klos- terstätte beschrieben und die Fragmente ausgestellt. Der zweite Raum führt den Besucher bergab, hinein in den Berg. Durch präzise gesetzte Stufen nach unten, wird die metaphysische Idee des Absteigens zu einer erdhaftigen, terrestrischen und erlebbaren Erfahrung. Unabhängig von Raum und Kontext werden hier ur- sprüngliche Sehnsüchte angesprochen, abseits von all den Ablenkungen der Um- welt. Die Heimstätte des heiligen Heimerads, der Bewahrer des Berges.
In beiden Räumen finden wir prägnante Fragmente des Klosters wieder, die hier zum ersten Mal öffentlich ausgestellt werden.
Das Pergamon Museum, erbaut von Fritz Wolff, in Berlin, ist eines der bekanntes- ten Speicherstätten von Fragmenten. Der Baukörper ist hierbei äußerst schlicht gehalten und nimmt sich zurück. In erster Weise dient der Bau den alten Perga- mon Tempel gebührend zu inszenieren und einen Raum im Raum zu kreieren. Architektur selbst wird hier zum Objekt, zum Kunstwerk und ausgestellt. Oswald Matthias Ungers beschreibt es als Haus im Haus. Dabei wird durch die Sicherheit der fernen Mauern des Museums und die dadurch entstehende Geborgenheit die Möglichkeit gegeben das Kunstwerk erstmals gebührend zu betrachten.
Das Archiv für die Kunst ist ein gegenwärtiges Thema in unserer Gesellschaft, wie gehen wir mit dem Vergangenen um? Brancusis Atelier zeigt eine Ansammlung von Geometrien im Raum, die einzig und allein von oben belichtet werden, dabei sind es Fragmente die in Beziehung zueinander einen geometrischen – ästheti- schen Raum aufspannen. Von der Baukunst, bis hin zur Geschichte prägend für unsere Gesellschaft. Die Faszination beginnt hierbei mit antiken Ruinen und alten Tempelanlagen, Fragmenten, Architektur die inhärent von ihrer Umgebung und ihrem System ist, aber dessen Idee und Vorstellung in unseren Erinnerungen und damit unserer Zeit weiterlebt.
Piranesis Architekturvorstellungen, Zeichnungen und Bilder beschreiben ganze Landschaften. Architektur wie sie sich mit der Zeit zersetzt und neu ordnet, neu findet. Es sind Objekte die frei in der Landschaft ausgestellt werden und doch in den Dialog mit der Umwelt treten. Architekturfantasien und Inkunabeln.
Tempelanlagen bilden einen geschützten Raum. Ein gefestigter Sockel, hohe Pi- laster, die einen Rahmen um das Innere bilden und einen Abschluss durch eine At- tika erhalten. Ein Zitat der Urform von Architektur. In diesen Räumen findet sich das Motiv der gerahmten Türe, der falschen Tür in Karnak wieder, wie es Robert Venturi in Complexity and Contradiction beschreibt. Durch eine wiederholen- de Rahmung der äußeren Schichten wird den eingeschlossenen inneren Räumen eine erhöhte Bedeutung verliehen, weil sie diese als beschützt, und damit mysti- fiziert erscheinen lassen. Die Tür in Karnak ergibt vielfach Reliefschichten, und in der Beschränkung auf zwei Dimensionen der Fläche ähneln sie dem entwick- lungsträchtigen Motiv der ineinandergesteckten Spieleier oder Holzpuppen, der russischen Matrjoschka.
Das Haus steht am Hang, es ist leicht und schwer, präzise, erlebbar und doch nicht ganz fassbar, frei im Raum. Es zeichnet sich durch seine erstaunliche Einfachheit aus, der keine Konkurrenz zum Ausstellungsobjekt darstellt, sondern mit ihm in den Dialog tritt. Fragment und Hülle bilden eine Einheit, dabei wird das Frag- ment durch eine sanfte Beleuchtung von oben erstmals erlebbarer Raum.
_